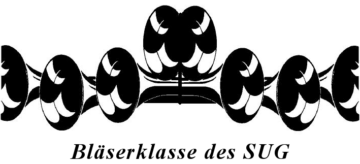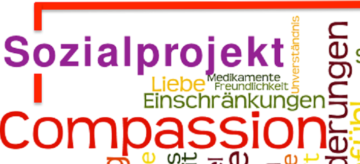Willkommen am St.-Ursula-Gymnasium in Arnsberg!


Aktuelles

Veranstaltungen
|
20.12.2025
Seit 23.00 Uhr ist das Weihnachtsvolleyballturnier 2025 schon wieder Geschichte …

Veranstaltungen
|
19.12.2025
Der Weihnachtsgottesdienst in St.-Johannes!

Neuigkeiten
|
17.12.2025
Das SUGO bringt adventliche Stimmung in Seniorenheime.
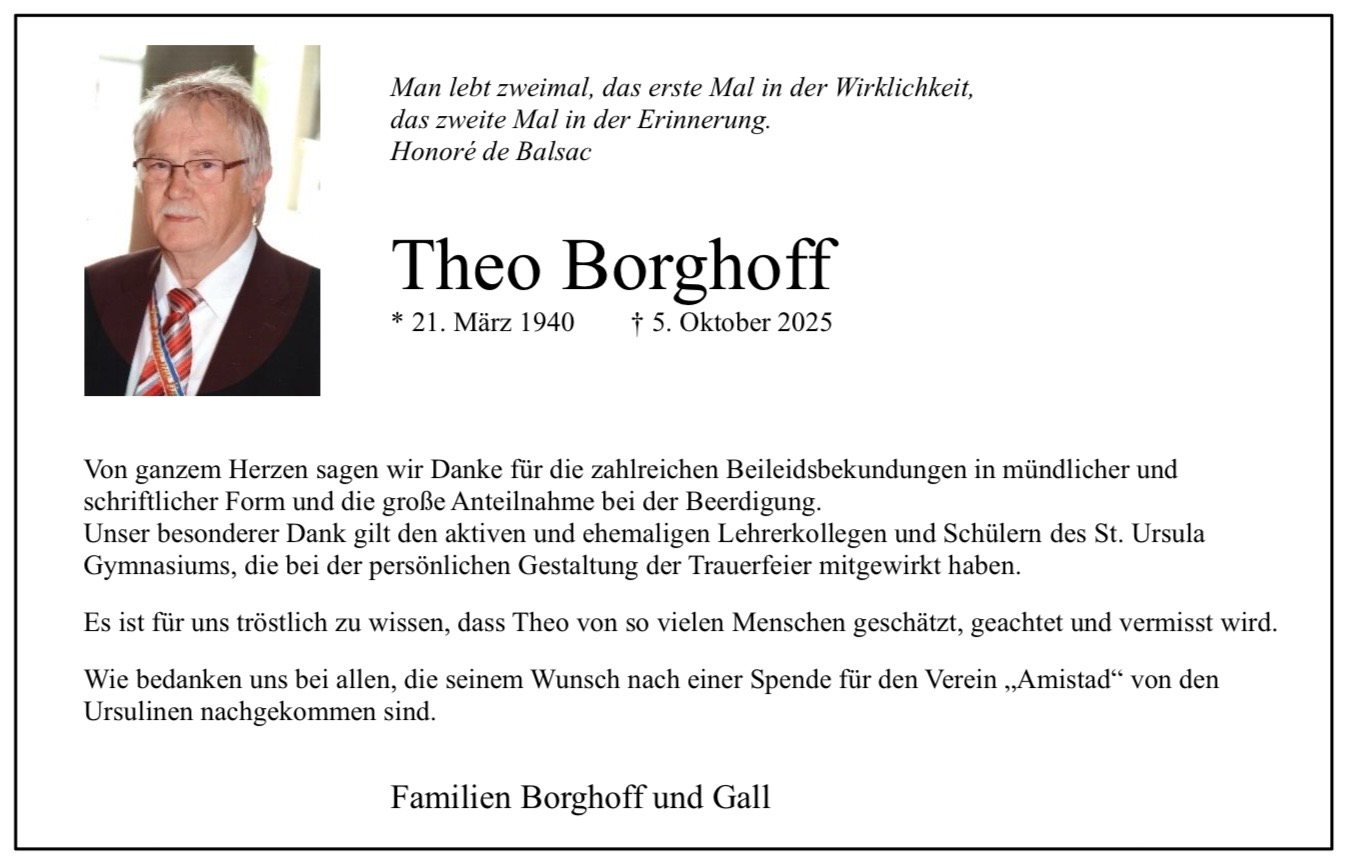
Screenshot
Allgemeine Informationen
|
14.12.2025
Danksagung …

Neuigkeiten
|
09.12.2025
Die weihnachtliche Spendenaktion für die Tafel …

Neuigkeiten
|
08.12.2025